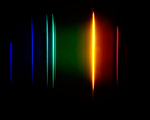Die Wärmestrahlung von Festkörpern ist der Untersuchungsgegenstand dieses Versuchs.
Aus der temperaturabhängigen spektralen Strahldichte einer Wolfram-Bandlampe wird bei zwei verschiedenen Wellenlängen der Quotient aus Planckschem Wirkungsquantum h und der Boltzmannkonstanten k bestimmt.
Zusätzlich wird die Gültigkeit des Stefan-Boltzmannschen Strahlungsgesetzes für die eingesetzte Lichtquelle überprüft.
Die Temperaturmessung der Lichtquelle erfolgt mit einem Teilstrahlungs-Pyrometer, zur Ermittlung der spektralen Strahldichte wird ein optisches Wechselsignalverfahren eingesetzt.
Versuchsanleitung